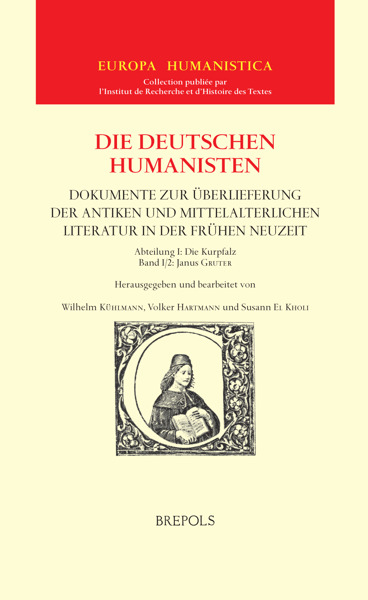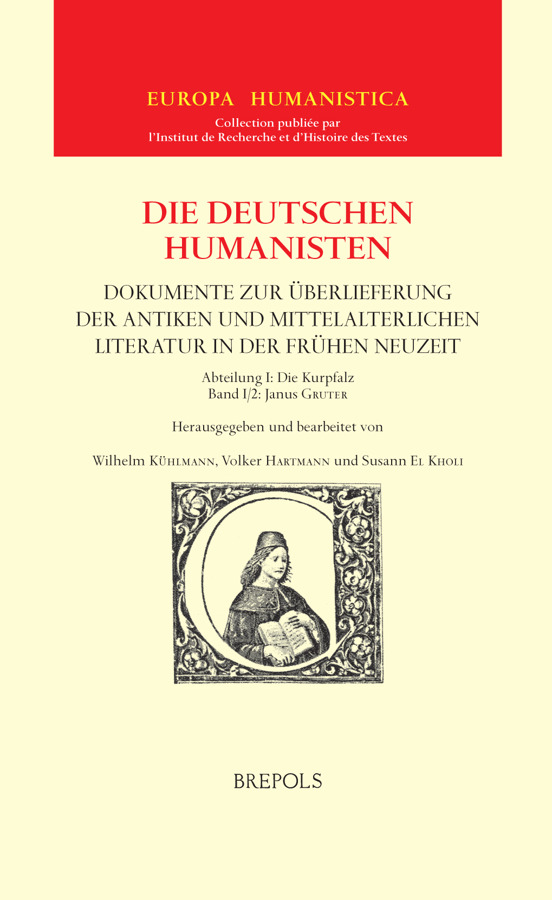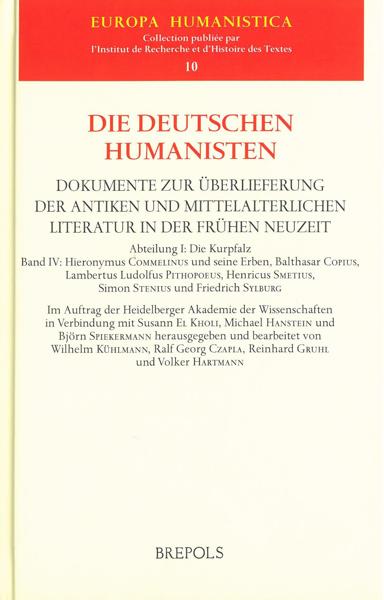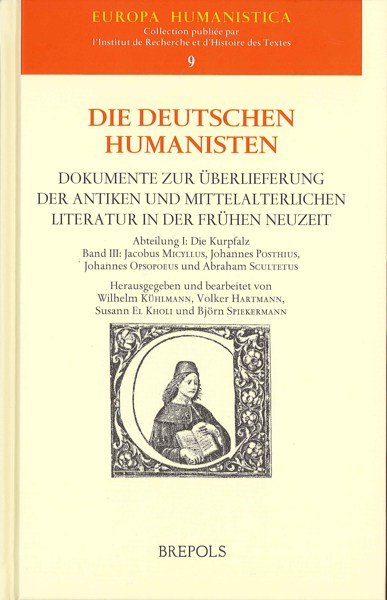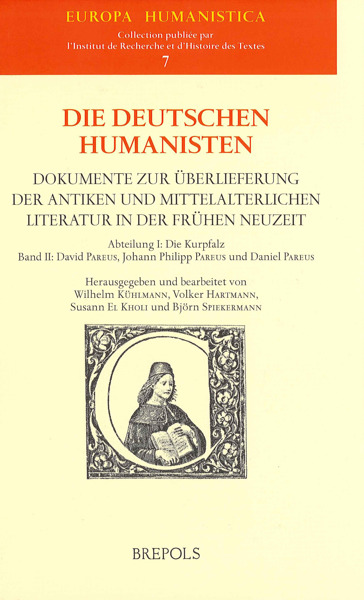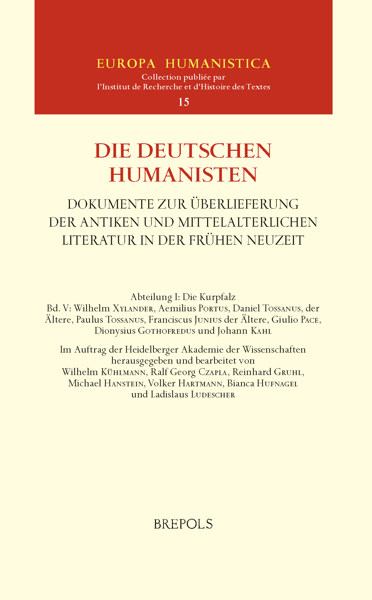
Die deutschen Humanisten. Dokumente zur Überlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur in der Frühen Neuzeit
Abteilung I: Die Kurpfalz. Band I, 1-2. Marquard Freher - Janus Gruter
W. Kühlmann, V. Hartmann, S. El Kholi
- Pages:2 vols, 1222 p.
- Size:155 x 240 mm
- Language(s):German, Latin, Greek
- Publication Year:2005
- € 85,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-52017-9
- Hardback
- Available
Das editorische Oeuvre Marquard Frehers umfaßt 33 Ausgaben (darunter auch Editiones principes, u.a. Straßburger Eide, Peter von Andlau) überwiegend lateinischer Quellen, daneben volkssprachige Denkmäler in althochdeutschem, frühmittelhochdeutschem und altenglischem Idiom, ferner byzantinische Texte. Postum erschienen sieben Editionen, davon vier herausgegeben von Frehers Drucker Gotthard Vögelin. Die Mehrzahl der edierten Texte stammt aus dem Mittelalter, eine kleinere Gruppe bilden Schriften von Juristen der frühen Neuzeit. Die Antike ist mit der Mosella des Ausonius und den Facetiae des Pseudo-Hierokles vertreten. Schwerpunkte bilden Kompendien zur Nationalgeschichtsschreibung (Germanicarum rerum scriptores, Corpus Francicae historiae, Moscoviticarum rerum scriptores, Scriptores rerum Bohemicarum, Quellen zur Geschichte Siziliens) und einzelne Quellen zur mittelalterlichen Geschichte wie die Goldene Bulle, die in vielen Fällen die Verbindung von Frehers juristischen und historischen Interessen darlegen. Zu den Editionen, die am längsten nachwirkten, gehören die zweibändige Ausgabe der Opera historica des Johannes Trithemius und eine von Johannes Leunclavius zusammengestellte Sammlung byzantinischer Rechtstexte, die 1966 bzw. 1971 nachgedruckt wurden. Einige dieser Editionen geben sich als Auftragsarbeiten des Heidelberg Hofes zu erkennen, die dessen Position in juristischen Angelegenheiten stützen sollten.
Im Zentrum des Gruterschen Werkes mit 30 Editionen stehen die auch heute noch kanonischen Autoren der lateinischen Antike. Die Historiker sind mit Florus, Sallust, Livius (drei verschiedene Ausgaben), Tacitus und der aus verschiedenen Werken der Antike und des Frühmittelalters kompilierten Historia Augusta Romana besonders prominent vertreten. Für Livius führte Gruter die heute noch übliche Zitierweise ein. Weit über Deutschland hinaus wirkten auch die Ausgaben des älteren und jüngeren Seneca, Ciceros, Martials und in besondere der römischen Inschriften – ein Produkt überregionaler und interkonfessioneller Kooperation zahlreicher europäischer Humanisten. Die Plautus-Ausgabe von 1621 ist zugleich Dokument der mit unerbittlicher Härte ausgefochtenen Auseinandersetzung mit dem früheren Schüler Johann Philipp Pareus. Ein weiterer Schwerpunkt von Gruters Arbeit war die Anlage von Florilegien, die er unter den Titeln Florilegium ethico-politicum, Bibliotheca exulum und Polyanthea publizierte. Griechisches ist mit Theophylaktos Simokattes, Onasandros, Pseudo-Maurikios und einer Sammlung von Orationes politicae vertreten. Beispiel einer späten Erstrezeption sind die 1851 publizierten Noten zu Statius.