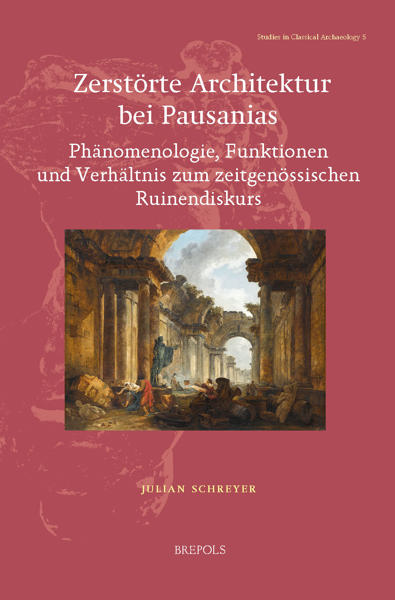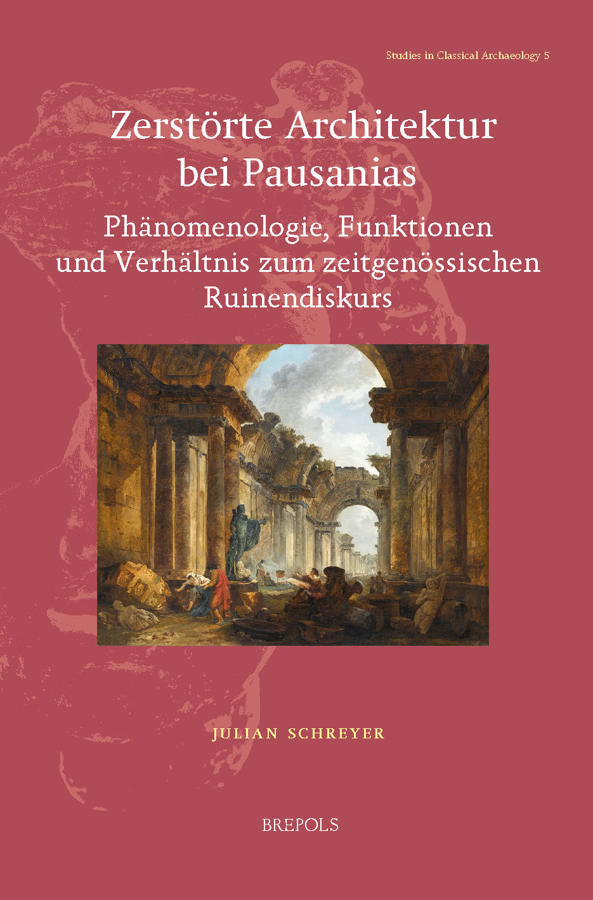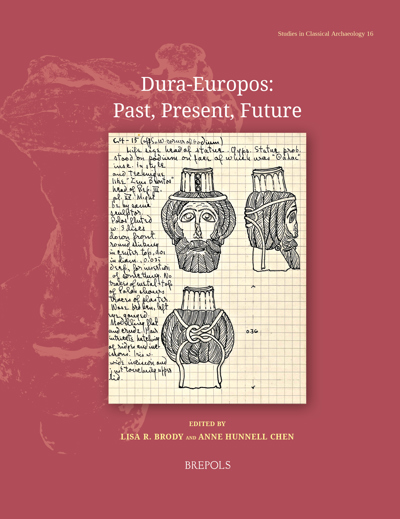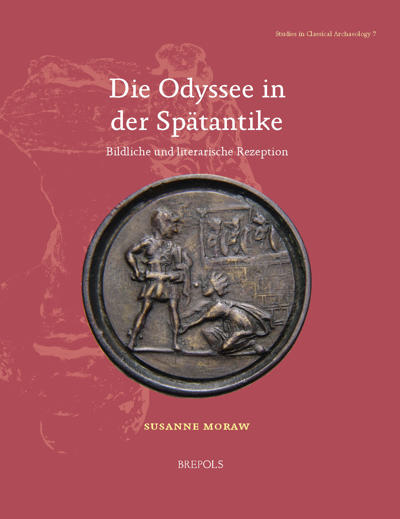
Zerstörte Architektur bei Pausanias
Phänomenologie, Funktionen und Verhältnis zum zeitgenössischen Ruinendiskurs
Julian Schreyer
- Pages: xvi + 500 p.
- Size:156 x 234 mm
- Illustrations:21 b/w, 7 col.
- Language(s):German
- Publication Year:2019
- € 130,00 EXCL. VAT RETAIL PRICE
- ISBN: 978-2-503-57974-0
- Hardback
- Available
Die Untersuchung stellt sich die Frage, weshalb die ,Periegesis Hellados‘ des Pausanias aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. so häufig Siedlungen und Gebäude im Zustand der Zerstörung thematisiert. Die ,Periegesis Hellados‘ unternimmt eine räumlich organisierte Zusammenstellung von Wissen, insbesondere zur myth-historischen Vergangenheit sowie zu den Kulten der Griechen, und schreibt sich auf diese Weise in zentrale Diskurse der Zweiten Sophistik ein. Die prominente Rolle, die zerstörte Architektur im Werk des Pausanias spielt, wurde bislang nicht systematisch analysiert. Hier setzt die Untersuchung an. Alle einschlägigen Textpartien werden vorgelegt und innerhalb zweier entscheidender Bezugshorizonte ausgewertet: zum einen im Rahmen der inhärenten Logik der ,Periegesis Hellados‘, zum anderen im Verhältnis zum zeitgenössischen Ruinendiskurs. Welch essenziellen Stellenwert die Ruine für die Programmatik und das Selbstverständnis des Textes einnimmt, kann auf diese Weise erstmals umfassend nachgezeichnet werden.